
IF - Zeitschrift für Innere Führung
Vielseitig. Analytisch. Kontrovers.
Um aus Fehlern zu lernen, sie zu vermeiden und als Gemeinschaft von ihnen zu profitieren müssen Organisationen wie die Bundeswehr systemische Voraussetzungen schaffen. Mit dem Fehlermeldesystem Flugbetrieb verfügen die Streitkräfte bereits über ein in Jahrzehnten gereiftes Instrument, das Verantwortung und Vertrauen in den Vordergrund stellt und aus dem wir alle lernen können.

Vom Start bis zur Landung muss jeder Schritt sitzen. Ein Tornado der Luftwaffe bei der Einweisung vor dem Abflug.
Bundeswehr / Andrea BienertDie Entscheidung zur Einrichtung des Fehlermeldesystems Flugbetrieb der Bundeswehr fiel, als im Jahr 2010 der damalige Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Aarne Kreuzinger-Janik, von einer Dienstreise aus Finnland zurückkehrte. Dort hatte man dem Inspekteur ein System zur Meldung von Fehlern im Flugbetrieb vorgestellt, das völlig freiwillig, anonym und nicht mit Sanktionen verbunden war.

„Jeder Fehler erscheint unglaublich dumm, wenn andere ihn begehen“ (Georg Christoph Lichtenberg)
Bundeswehr / Andrea BienertNachdem die hierfür erforderlichen Konzepte, Anträge und Vorschriften geschrieben, gestellt und erlassen worden waren, wurde am 14. Dezember 2011 schließlich das „Fehlermeldesystem für den Flugbetrieb in der Bundeswehr“ beim damaligen Luftwaffenamt, Abteilung Flugsicherheit, in Dienst gestellt.
Im Bereich des Flugbetriebs in der Bundeswehr gab es vor der Einführung des Fehlermeldesystems diverse Ansätze mit dem Themenkomplex „Fehler“ umzugehen. Insbesondere in Form des Cockpit Ressource Managements (heutiger Begriff: Human Factors (HF)), wurde seit der Jahrtausendwende auch bei der Bundeswehr durch Schulungen des fliegenden Personals versucht, die Rate an Komplikationen und Zwischenfällen (Fehlern) durch eine Optimierung der menschlichen Zusammenarbeit und Leistung zu reduzieren. Zunächst fanden diese Schulungen alleinig für Luftfahrzeugbesatzungen statt, mittlerweile sind Aus- und Weiterbildungen HF für alle am Flugbetrieb beteiligten Personen (vom Feuerwehrmann, dem Luftfahrzeugtechniker, dem Flugverkehrskontrolloffizier bis zum Luftfahrzeugführer) verpflichtend.
Warum tut sich der Mensch so schwer, einen Fehler zuzugeben oder gar zu melden? Die Gründe hierfür sind unterschiedlich und oftmals auch vielschichtig. James Reason definiert den Fehler als Folge von mentalen oder physikalischen Aktivitäten, die nicht das gewollte Resultat erzielen. In den konzeptionellen Grundlagen für Flugsicherheit der Bundeswehr ist definiert, dass ein Fehler –im Gegensatz zu einem Verstoß – immer ungewollt oder unbewusst geschieht und so als ein wertneutrales Delta zwischen ursprünglicher Absicht und dem Ergebnis einer Handlung beschrieben wird.

"Eines der traurigsten Dinge im Leben ist, dass ein Mensch viele gute Taten tun muss, um zu beweisen, dass er tüchtig ist, aber nur einen Fehler zu begehen braucht, um zu beweisen, dass er nichts taugt" (George Bernard Shaw)
Bundeswehr / Andrea BienertInsbesondere im Bereich des Flugbetriebs ist es essenziell, aus Fehlern zu lernen. Es reicht aus, wenn ein Fehler einmal gemacht wird, dieser muss nicht mehrfach wiederholt werden. Dafür ist das damit verbundene Risiko für die Gesundheit aller Beteiligten zu hoch. Den Fehler lediglich sich selbst einzugestehen oder einem Vertrauten gegenüber zuzugeben reicht daher nicht aus. Es müssen alle von diesem Fehler lernen, damit dieser in Zukunft vermieden werden kann. Bei einem Flugbetrieb mit einer guten Fehlerkultur wird in der Regel ein Fehler freiwillig bei einem Briefing vorgetragen. Dazu braucht es Mut und ein gutes Maß an Vertrauen, vor anderen zu berichten wie es zu einem Fehler gekommen ist. Hierbei ist es essenziell wichtig und entscheidend, welche Kultur des zwischenmenschlichen Umgangs gepflegt wird. Jeder sollte sich dabei selbst fragen, ob ihm so etwas nicht vielleicht selbst hätte passieren können. Vom Zuhörer ein Lachen, ein Kopfschütteln, selbst ein Schmunzeln zu empfangen kann dazu führen, dass der Erzähler seinen möglichen Fehler verschweigt. So etwas ist für eine gute Fehlerkultur schädlich und muss zwingend vermieden werden. Aus diesem Grund müssen sich im Besonderen auch Vorgesetzte im Aufbau und in der Gestaltung einer Fehlerkultur ihrer großen Verantwortung bewusst sein und in ihrem Bereich eine offene, respektvolle Kommunikation fördern. Dazu gehört auch einen Fehler nicht sofort nicht vorschnell als Verstoß zu behandeln, sondern zunächst die Hintergründe zu analysieren.
Es hilft nicht zu wissen, „wer Schuld hat“. Das macht das Fliegen nicht sicherer! Viel wichtiger ist die Frage nach dem „Warum“!
Gemachte Fehler zu erkennen, darüber zu berichten, damit andere daraus Lehren ziehen können, ist ein hohes Gut im Flugbetrieb. Sich mit dem Thema des gemachten Fehlers nicht nur alleine zu befassen und sich mitzuteilen, bleibt nicht nur beim Berichterstatter, sondern auch bei den Zuhörern in einer gesunden Fehlerkultur nachhaltig haften und führt dazu, dass aus diesem Fehler gelernt wird.
Ein Baustein der beschriebenen und gelebten Fehlerkultur ist das eingangs erwähnte Fehlermeldesystem. Bei der Einrichtung des Fehlermeldesystems wurde darauf geachtet, dass kein truppendienstliches Vorgesetztenverhältnis zwischen den Meldenden und der die Meldung aufnehmenden Stelle besteht. Dies erklärt die Verortung des Meldesystems beim General Flugsicherheit in der Bundeswehr (GenFlSichhBw).
Dieses System hat im Umgang mit Fehlern für die Flugsicherheit neue Wege eröffnet. Potenziell flugsicherheitsgefährdende Entwicklungen und Tendenzen, aber auch nicht effiziente Handlungsabläufe, werden frühzeitig mit Hilfe von Datenerfassung, Analyse und Evaluierung von Fehlern, die nicht zu einem Unfall oder Zwischenfall geführt haben, identifiziert. Die so gewonnenen Erkenntnisse aus dem Meldesystem sind grundsätzlich allen am Flugbetrieb Beteiligten offen zugänglich. Zentrales Element des Meldesystems ist die Weitergabe von Informationen durch alle am Flugbetrieb Beteiligten. Die Informationen können vertraulich oder anonym gemeldet werden. Eine Meldung kann wahlweise über die Homepage der Abteilung GenFlSichhBw zur direkten Dateneingabe, als Anhang einer E-Mail, in Papierform oder telefonisch erfolgen.

Ein Pilot im Cockpit eines Eurofighters vom Taktischen Luftwaffengeschwader 73 Steinhoff.
Bundeswehr / S. PetersenEine Rückmeldung, eine Weitergabe der Meldung oder der Erkenntnisse erfolgt auf drei Ebenen. Die erste Ebene beinhaltet - wenn möglich - eine zeitnahe persönliche Rückmeldung an die meldende Person. Die zweite Ebene der Weitergabe erfolgt über eine vierteljährliche Veröffentlichung ausgewählter, anonymisierter Meldeinhalte in der Zeitschrift „Flugsicherheit“, zu denen die Einwilligung der Meldenden vorliegt. In der dritten Ebene werden, im Rahmen einer Führungsberatung, Empfehlungen durch den GenFlSichhBw ausgesprochen.
Aus dem „Fehlermeldesystem“ von einst wurde 2018 das „Freiwillige Meldesystem Flugbetrieb“. Die neue Namensgebung war aus Sicht der Betreiber des Systems notwendig geworden, da der Begriff Fehler – obwohl im Bereich der Human Factors-Ausbildung fest verankert und definiert – noch immer negativ behaftet scheint.
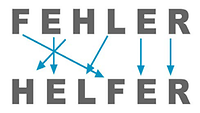
Jeder Fehler kann eine Organisation voranbringen.
Enrico Pfützner (enricopfuetzner.de)Das System basiert auf dem vertrauensvollen Umgang mit Fehlern und ist eine Ergänzung zu einer gut gelebten Fehlerkultur bei Vorgesetzten und allen Beteiligten im Flugbetrieb der Bundeswehr, die das Lernen aus Fehlern, und nicht die Ahndung von Fehlern, zum Gegenstand hat.
Vertrauliche Meldungen an das Freiwillige Meldesystem werden verifiziert und Defizite hinsichtlich der Vollständigkeit sowie der Verständlichkeit mit dem Meldenden geklärt. Sowohl die Verifizierung als auch die Klärung von Unstimmigkeiten ist bei anonymen Meldungen grundsätzlich nicht möglich. Alle anonymen Meldungen werden daher einer Plausibilitätskontrolle unterzogen, bevor sie berücksichtigt werden. Der Fokus liegt dabei auf menschlichem Verhalten und nicht auf technischen Fehlfunktionen.

„Die Frage nach dem ‚Warum‘ spielt in einer konstruktiven Fehlerkultur die Hauptrolle, nicht die Frage nach dem ‚Wer‘." (Brigadegeneral Andreas Korb)
Bundeswehr / Pressestelle Luftfahrtamt der BundeswehrIm Jahr 2020 wies das Bundesministerium der Verteidigung die Einführung eines Sicherheitsmanagementsystems in den Flugbetrieb in der Bundeswehr an und setzte damit die neuesten Entwicklungen zur Verbesserung der Flugsicherheit in der Luftfahrt im eigenen Geschäftsbereich um. Durch die Einbindung der Management- und Entscheidungsebene in Sicherheitsmanagementsysteme wird nach Studien und Erkenntnissen der International Civil Aviation Organisation (ICAO) und der European Union Aviation Safety Agency (EASAEuropäische Agentur für Flugsicherheit) ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Sicherheit in der Luftfahrt geleistet. Das verpflichtende Engagement der Leitung durch messbare Vorgaben zur Förderung der Sicherheit und der Gewährleistung der Sicherheit im Flugbetrieb sowie die Definition von Richtlinien von Sicherheitszielen und Verfahren eines Risikomanagements streben gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten im Sinne der Flugsicherheit an. Wichtiger und zentraler Bestandteil des Sicherheitsmanagementsystems ist ein integriertes, offenes, transparentes und mit einem Feedbacksystem versehenes Meldesystem. Das bereits bestehende und bewährte „Freiwillige Meldesystem Flugbetrieb“ stellt hierbei eine exzellente Grundlage zur Etablierung eines solchen Meldesystems und dessen Weiterentwicklung der Zukunft dar.
Fehler passieren. Nur, wer gar nichts macht, macht keine Fehler. Die Frage ist, wie wir mit ihnen umgehen. In der Sommerausgabe der IF (PDF, 8,0 MB) nehmen wir das Thema Fehlerkultur unter die Lupe. Wie die Bundeswehr als Organisation aus Fehlern lernen kann, beschäftigt auch den Generalinspekteur. In einem Interview spricht er über Ergebnisse des Programms „Innere Führung – heute“ des Bundesministeriums der Verteidigung und wirft einen Blick in die Zukunft.
Außerdem im Heft: Die Lage im kriegszerstörten Syrien, eine Ausstellung des Militärhistorischen Museums der Bundeswehr in Dresden mit dem Titel „Hitlers Elitetruppe? Mythos Fallschirmjäger“ und vieles mehr. Haben Sie Kritik, Ideen - oder einen Fehler gefunden? Wir freuen uns über jedes Feedback!

Vielseitig. Analytisch. Kontrovers.