
Marinehubschrauber Sea Lion erstmals im Einsatz an Bord
Auf der monatelangen Präsenzfahrt Atlantic Bear müssen sie jetzt beweisen, dass sie auch für die Hohe See geeignet sind.

Auf der monatelangen Präsenzfahrt Atlantic Bear müssen sie jetzt beweisen, dass sie auch für die Hohe See geeignet sind.
„Hubschraubernotlage! Hubschraubernotlage!“, schallt es aus den Lautsprechern des Einsatzgruppenversorgers „Berlin“. Das bedeutet, die Piloten des Bordhubschraubers vom Typ Sea Lion haben schwerwiegende Probleme mit ihrer Maschine – und das mitten auf dem Nordatlantik. Weit und breit ist kein Land in Sicht. Eine Landung auf festem Boden ist ausgeschlossen. Die einzige Option: die rasche Rückkehr zur „Berlin“ und eine Notlandung auf ihrem in den Wellen schwankenden Landedeck. Keine leichte Aufgabe mit verminderter Leistung der Triebwerke.
Allzweckwerkzeug und Lebensretter
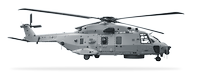
Die Riesen der Flotte sind Multifunktionsschiffe für die Seeversorgung.

Der Wachoffizier auf der Brücke des Einsatzgruppenversorgers sorgt dafür, dass sich das 20.000-Tonnen-Schiff für den Hubschrauber optimal zum Wind ausrichtet. Zeitgleich machen sich die Rettungs- und Löschtrupps im Hangar bereit, sollte bei der Notlandung etwas schiefgehen. Die Männer und Frauen positionieren sich nah am Flugdeck, halten aber Sicherheitsabstand.
Wenig später taucht der Sea Lion im Grau des Nordatlantiks auf. Der Übergang zwischen Wellen und Wolken ist fließend. Die Maschine kommt zügig näher. Jetzt ist nur noch der Flugdeckoffizier auf dem Landedeck und weist den Sea Lion über Winkzeichen ein. Er muss einen guten Moment erwischen, in dem die „Berlin“ sich möglichst wenig bewegt. Ansonsten könnte das Schiff von unten gegen den landenden Hubschrauber schlagen und ihn ernsthaft beschädigen.
Dann ist es so weit: Der Flugdeckoffizier wähnt einen günstigen Moment und gibt das Winkzeichen zur Landung. Die finale Entscheidung liegt aber beim Piloten. Auch er entscheidet sich, zu landen und setzt den Hubschrauber aufs Deck auf. Sofort klammert sich der Greifarm an der Unterseite des Sea Lion in das Gitter auf dem Landedeck und hält die Maschine fest an Bord. Die Landung ist geglückt und die Übung beendet.
Sowohl für die Marineflieger als auch die Mannschaft der „Berlin“ sind die Übungen im Flugbetrieb extrem wichtig. Denn der Sea Lion ist das erste Mal über mehrere Monate im operativen Betrieb an Bord eines Schiffs der Marine. Es gibt also noch kaum Erfahrungen, wie sich das System verhält, wie gut es an Bord zu warten ist und wo die Tücken liegen. Das alles gilt es, während der viereinhalbmonatigen Präsenzfahrt Atlantic Bear herauszufinden. Darauf haben sich die Marineflieger intensiv vorbereitet.
„Wir haben Personal in Decklandungen mit dem NHNATO-Helicopter-90 Sea Lion ausgebildet, um diese Einschiffung darstellen zu können“, erklärt Fregattenkapitän Marc Philipp M.*, Sea-Lion-Pilot und verantwortlich für das gesamte fliegende Personal an Bord. Zudem seien Piloten dabei, die schon viel Erfahrung auf dem Sea Lion sammeln konnten, führt er weiter aus. Seit Juli 2023 befindet sich der neue Hubschraubertyp in der Bereitschaft für SARSearch and Rescue-Missionen über der Nord- und Ostsee und hilft bei der Suche und Rettung in Not geratener Personen. Dazu starten die Crews mit ihrer Maschine bislang aber immer vom festen Boden ihres Heimatstandorts in Nordholz.
Einen Hubschrauber von Bord aus zu betreiben, ist etwas völlig anderes. Damit die beiden Sea Lions überhaupt vom Deck der „Berlin“ abheben können, braucht es die technische Crew. „Zunächst mussten wir von unseren Maschinen diejenigen identifizieren, die das geplante Flugstundenkontingent während der mehrmonatigen Seefahrt am besten absolvieren können. Hintergrund ist, dass jedes Luftfahrzeug regelmäßig größeren technischen Wartungen unterliegt, die nicht an Bord durchgeführt werden können. Daher nehmen wir die Hubschrauber mit, die diese Wartung erst kürzlich hinter sich haben“, erklärt der Luftfahrzeugtechnische Offizier, Oberleutnant zur See Jan O. „Zudem muss man natürlich das passende Personal auswählen und die richtigen Ersatzteile mitführen. Vom O-Ring bis zum Rotorblatt haben wir alles dabei“, so der Techniker.

Sowohl beim Start als auch bei der Landung stimmen sich der Flugdeckoffizier und der Pilot des Sea Lion eng ab. Die Kommunikation erfolgt über Winkzeichen.
Bundeswehr/Christoph Kassette
Fällt eine Person ins Wasser oder muss vom Deck eines anderen Schiffs geholt werden, nutzt die Besatzung ihre Winde, um sie an Bord zu holen
Bundeswehr/Christoph Kassette
Unter dem Sea Lion befindet sich im runden Radom ein leistungsstarkes Seeraumüberwachungsradar, mit dem der Hubschrauber zum fliegenden Auge des Schiffs wird
Bundeswehr/Christoph Kassette
Vor der Landung schwebt der Hubschrauber zunächst seitlich neben dem fahrenden Schiff. Dann schwenkt er über das Flugdeck und wartet auf den passenden Moment zur Landung.
Bundeswehr/Christoph Kassette
Die technische Crew sorgt auch mitten auf dem Atlantik dafür, dass die Sea Lions immer einsatzbereit sind
Bundeswehr/Christoph Kassette
Zusammengefaltet und fest verzurrt im Hangar überstehen die Sea Lions auch extreme Schwankungen an Bord des Einsatzgruppenversorgers „Berlin“
Bundeswehr/Christoph Kassette„Er fliegt sich sehr sportlich. Diese Maschine will auf jeden Fall fliegen“, berichtet Fregattenkapitän M. „Unsere Marschgeschwindigkeit liegt in der Regel zwischen 120 und 140 Knoten, das sind bis zu 260 Kilometer pro Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit liegt sogar bei 175 Knoten. Das ist jedoch eher ein theoretischer Wert, denn in der Fliegerei hängt die Geschwindigkeit immer stark von Faktoren wie Luftdruck, Luftdichte und Temperatur ab“, führt der erfahrene Flieger weiter aus.
Marc-Philipp M. ist auch schon den Vorgänger des Sea Lion geflogen, den Sea King: „Im Vergleich zum 50 Jahre alten Sea King ist der Sea Lion natürlich sehr modern. Er kann bei stärkerem Wind und Wellengang fliegen. Mithilfe seines Greifarms hält sich der Hubschrauber bei einer Landung fest an Deck, um bei Wellengang nicht ins Rutschen zu geraten. Wir sprechen hier beinahe von einer Verdopplung der Neigungswinkel, die das Schiff und damit auch das Flugdeck haben darf, im Verhältnis zum Sea King.“
Auch die Übertragung der Flugeingaben des Piloten an die Rotoren habe sich grundlegend verändert. „Der Sea King war analog. Die Eingaben des Piloten wurden über Bowdenzüge und hydraulische Verbindungen an die Rotoren weitergeleitet. Im Sea Lion ist alles Fly-by-Wire. Das heißt, meine Steuereingaben werden als digitale Signale an die Computer übertragen, die dann die Rotoren ansteuern“, erläutert der Pilot. „Dadurch, dass ein Computer zwischengeschaltet ist, werde ich als Luftfahrzeugführer insbesondere bei sogenannten Transitflügen von A nach B durch den Dreiachsenautopiloten stark entlastet und kann mich so viel besser auf den eigentlichen Auftrag fokussieren, beispielsweise die Überprüfung von Radarkontakten oder das Finden von Personen.“

„Wir sind das fliegende Auge des Schiffs.“
Doch nicht nur die Piloten müssen sich auf das „digitale Fliegen“ einlassen. Auch für die Technikerinnen und Techniker ändert sich einiges. „Weniger Mechanik und mehr Software bietet einige Vorteile. So können beispielsweise Fehler direkt über den Laptop ausgelesen werden. Dabei wird einem auch von der Software vorgeschlagen, wie dieser behoben werden kann“, erklärt Oberleutnant zur See Jan O. Doch es gebe auch Nachteile. Denn manchmal sei in der Software einfach der Wurm drin und dann beginne eine müßige Fehlersuche, beschreibt der Luftfahrzeugtechnische Offizier. Er fügt aber hinzu: „Wir versuchen hier auf dem Atlantik natürlich nah an das ranzukommen, was wir auch am Heimatstandort in Nordholz technisch leisten können, und dafür zu sorgen, dass die Hubschrauber möglichst immer einsatzbereit sind.“
Die Marineflieger, die nicht zur Stammbesatzung eines Schiffs gehören, erweitern mit ihren Bordhubschraubern die Fähigkeiten des Einsatzgruppenversorgers enorm. „Primär sind wir für den Personal- und Materialtransport zuständig. Wir machen aber auch Such- und Rettungsflüge. Das heißt, wenn jemand über Bord gegangen ist, finden wir die Person, nehmen sie mithilfe der Winde an Bord und fliegen sie zurück zum Schiff“, erklärt der Fregattenkapitän Marc Philipp M.
Zudem ermöglicht der Sea Lion der Schiffsführung mit seinem leistungsstarken Seeraumüberwachungsradar einen Blick über den eigenen Radarhorizont. „Wir sind das fliegende Auge des Schiffs. Wir untersuchen zum Beispiel auch Kontakte, die für das Schiffsradar nicht identifizierbar sind. Dann fliegen wir dorthin und prüfen, ob es sich um eine Gefahr für das Schiff oder den Verband handelt“, so der Sea-Lion-Pilot.
Der Sea Lion ist der Nachfolger des langgedienten Sea King. Die neuen Bordhubschrauber erweitern die Fähigkeiten der Einsatzgruppenversorger ungemein. Ein Pilot an Bord der „Berlin“ erklärt, was vor, während und nach einem Flug passiert.
Mit Blick auf den erstmaligen operativen Einsatz der Sea Lions an Bord war Marc-Philipp M. am Anfang der Seefahrt eher skeptisch: „Was den Betrieb auf See angeht, gab es bisher eben noch keine Erfahrungen.“ Zu Beginn der Reise war die „Berlin“ dann in der Nähe von Schottland auch direkt in einen Sturm geraten, der die Sea Lions im Hangar stark beanspruchte. „In diesem Moment hatten wir besonders ein Auge auf die Verzurrpunkte und Sorge, dass der Hubschrauber durch die extreme Belastung Schaden nimmt. Doch alles hat gehalten“, erzählt der Fregattenkapitän. „Nach den ersten Wochen in See bin ich nun aber sehr positiv gestimmt. Wir hatten noch keine Störungen.“
Und auch nach über der Hälfte von Atlantic Bear haben es die Marineflieger geschafft, alle geforderten Flüge abzuleisten. „Die Sea Lions waren jederzeit technisch einsatzbereit“, berichtet der Jan O. „Die Hubschrauber hatten erstaunlich wenig Störungen und ich blicke positiv auf den zukünftigen Einsatz des Sea Lion an Bord der Einsatzgruppenversorger“, so der Oberleutnant zur See nicht ohne Stolz auf die Leistung seiner Mannschaft.
*Alle Namen zum Schutz der Personen abgekürzt oder geändert.

Fregattenkapitän Marc Philipp M. ist Sea-Lion-Pilot und verantwortlich für das fliegerische Personal an Bord des Einsatzgruppenversorgers „Berlin“ während der Präsenzfahrt Atlantic Bear
Bundeswehr/Christoph KassetteWelche Eigenschaften brauchen Marineflieger?

Als Flieger, egal welchen Posten man im Hubschrauber hat, muss man drei Eigenschaften haben: Erstens Teamfähigkeit, denn niemand fliegt allein. Zweitens Kritikfähigkeit. Egal wie viel Erfahrung man hat, man muss immer offen sein für gerechtfertigte Kritik der restlichen Besatzung. Und drittens der dauernde Anspruch zur Weiterentwicklung. Wer sagt, er wisse alles, gehört nicht ins Luftfahrzeug.
Was ist der Unterschied zwischen der Fliegerei auf See und der über Land?

Der maßgebliche Unterschied zum Fliegen über Land ist, dass unsere Landeplattform in Bewegung ist. Gleichzeitig haben wir die Situation, dass es auf hoher See keine Alternative zum Landedeck des Schiffs gibt. Man muss also wissen, wenn man startet, wo wird sich das Schiff später befinden, was mache ich, wenn es Probleme mit dem Luftfahrzeug gibt und wie komme ich dennoch wieder aufs Deck. Darüber hinaus muss man auch psychisch in der Lage sein, so fern ab von allem bei grauem Wetter über graue See zu fliegen. Da muss man auch ein bisschen bekloppt sein.
Wie landet man einen Hubschrauber mitten auf dem Ozean auf einer sich bewegenden Plattform?

Das ist ein Zusammenspiel zwischen der Besatzung des Hubschraubers und dem Flugdeckoffizier. Der Flugdeckoffizier steht an Deck und weist in beratender Funktion für den Piloten das Luftfahrzeug ein. Er versucht, die Schiffsbewegungen zu erkennen und im richtigen Moment das Winkzeichen zur Landung zu geben. Denn grundsätzlich gilt, dass auch bei starkem Wellengang es immer wieder Phasen gibt, in denen das Schiff ruhiger liegt, bevor es wieder wegkippt. Für die Besatzung des Hubschraubers heißt es, stabil die Position über dem Flugdeck zu halten, sich nicht vom Schaukeln des Schiffs irritieren zu lassen und die kommende Ruhephase zu erkennen. Am Ende trifft dann der Pilot die finale Entscheidung zur Landung.