
So soll das Heer digital werden
Das Deutsche Heer treibt seine Digitalisierung voran. Jetzt wurden die nächsten Schritte auf dem Weg dorthin veröffentlicht.
Digitalisierung ist das Topthema des 21. Jahrhunderts. Auch das Deutsche Heer ist mittendrin im Digitalisierungsprozess. Wie wird auf dem Gefechtsfeld von morgen gekämpft? Wie müssen die Soldatinnen und Soldaten von morgen ausgestattet und ausgebildet sein, um gemeinsam im Kampf zu bestehen?

Das Deutsche Heer ist mittendrin im Digitalisierungsprozess. Wir zeigen, wie auf dem Gefechtsfeld von morgen gekämpft wird.
Um Landoperationen zu digitalisieren, müssen sich die Landstreitkräfte weiterentwickeln. Als Nutzer komplexer Technik ist gerade das Heer besonders von der Digitalisierung betroffen. Sie erfordert nicht nur die Entwicklung und Einführung neuer Technologien in die Streitkräfte, sondern auch ein neues Denken und Handeln auf allen Ebenen. Unter der Federführung des Deutschen Heeres stellen sich die Landstreitkräfte, zusammen mit anderen Bereichen der Bundeswehr und internationalen Partnern aus Militär, Politik und Wirtschaft dieser Herausforderung. Um die Komplexität und Geschwindigkeit der Digitalisierung landbasierter Operationen gemeinsam zu bewältigen und sich auf zukünftige Aufgaben vorzubereiten, hat das Heer eine Strategie entwickelt und Strukturen ins Leben gerufen.
Die Strategie Digitalisierung Land ist eine Handlungsanweisung. Mit ihr soll der Prozess zur erfolgreichen Digitalisierung landbasierter Operationen langfristig strukturiert, alle damit verbundenen Projekte zeitlich harmonisiert und auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet werden. Im Zentrum steht hierbei die in der NATONorth Atlantic Treaty Organization und Europa einzigartige Zusammenarbeit mit den niederländischen Landstreitkräften. Sie spiegelt sich in der Aufstellung des I. Deutsch-Niederländischen Corps in Münster, in der Integration des deutschen und des niederländischen Heeres und in einer digitalen Rüstungskooperation wider. Sie ist der Motor und die Grundlage der Digitalisierung Land zugleich.
Digitalisierung im Heer meint die digitale Verknüpfung aller Fahrzeuge und Soldaten im Gefecht – neueste Funkgeräte und neueste Anzeigegeräte auf den Fahrzeugen. Wir sprechen darüber mit Oberst Frank Pieper, dem Chief Digital Officer Heer.
Begriffe wie Robotik, künstliche Intelligenz und Digitalisierung sind nicht Science-Fiction, sondern bereits jetzt Realität. Die rasche technische Entwicklung und die Nutzung neuer, innovativer Technologien in den aktuellen Konflikten treiben die Streitkräfte an, sich weiterzuentwickeln.
In den Einsatzszenarien der Zukunft muss das Heer dazu fähig sein, gemeinsam mit seinen Partnern robust und reaktionsfähig, interoperabel und flexibel sowie zuverlässig handeln zu können. Das Gefechtsfeld von morgen ist transparent und gläsern. Das bedeutet, dass durch die unmittelbare Vernetzung aller Akteure, wie beispielsweise von Nachrichtendiensten und Sensoren sowie weiterer militärischer und ziviler Akteure, das Handeln der eigenen Truppe sehr schnell beobachtet und überwacht werden kann. Im Gefecht der Zukunft besteht daher nur derjenige, der binnen kürzester Zeit die richtige Entscheidung trifft und mit seiner Truppe die richtige Wirkung erzielt.
Der mögliche Gegner der Zukunft verfügt über weitreichende, vernetzte Waffensysteme, mit denen er in allen Dimensionen kämpfen kann. Damit ist er in der Lage, eine Art Schirm über strategisch wichtige Gebiete zu spannen. Somit werden auch die Landstreitkräfte in ihrer Bewegung erheblich einschränkt. Mit Cyberangriffen versuchen gegnerische Kräfte, die Kommunikation der eigenen Truppe zu stören, zu verfälschen oder gar zu unterbinden. Klassische Konfliktschwellen verwischen. Somit ist unklar, ob es sich um einen Zufall oder bereits um eine militärische Operation handelt. Konflikträume verlieren ihre Grenzen und die Zugehörigkeit von Akteuren ist auf den ersten Blick nicht erkennbar.
Das Deutsche Heer muss künftig mit den NATONorth Atlantic Treaty Organization-Partnern und Verbündeten vernetzt sein, um gemeinsam agil und effizient auf dem Gefechtsfeld operieren zu können. Durch die Digitalisierung soll das Heer kompatibel und interoperabel werden. Das bedeutet, dass sich deutsche Landstreitkräfte durch technische Lösungen bruchfrei und problemlos mit den Systemen und Strukturen der NATONorth Atlantic Treaty Organization und ihrer Verbündeten koppeln lassen. Auch die Fähigkeitsbeiträge aus anderen Bereichen der Bundeswehr, wie beispielsweise Erkenntnisse aus dem Bereich Cyber- und Informationsraum sollen durch den Einsatz kompatibler Technologien problemlos integriert und synchronisiert werden können. Durch die Vernetzung erhält jeder Akteur, vom Soldaten im Gefecht bis hin zu den Kommandeuren in der Operationszentrale das Lagebild, das individuell benötigt wird, um die richtige Entscheidung treffen zu können.
Die Digitalisierung ist ein notwendiger Prozess, der die Truppe bei laufenden Einsätzen erheblich fordert. Sämtliche Fahrzeuge müssen daher umgerüstet, Personal geschult und die Abläufe angepasst werden. Die Ausstattung aller 27.000 Gefechtsfahrzeuge des Heeres wird daher über einen mehrjährigen Zeitraum verteilt werden. Die Entwicklung der neuen digitalen Technik und die Ausstattung der Truppe wird schrittweise erfolgen: „Man muss kleine überschaubare Inseln schaffen, diese durchdigitalisieren, das zum Erfolg führen und dann das Ganze inselartig ausbreiten lassen. Wir starten nicht mit einer kompletten Division oder einer Brigade, also nicht mit 30.000 Leuten oder 10.000, sondern wir starten mit einem Gefechtsverband. Das sind knapp 1.500 Leute und 800 Fahrzeuge. Und die werden wir im System durchdigitalisieren“, skizziert Oberst Frank Pieper. Als Chief Digital Officer für Landbasierte Operationen trägt er die Verantwortung für den Digitalisierungsprozess des Deutschen Heeres.
Im Gefecht kann Informationsüberlegenheit schnell über Sieg oder Niederlage entscheiden. Um ein aktuelles Lagebild in Echtzeit zu erhalten, müssen Mensch und Maschine mit leistungsfähigen digitalen Führungssystemen vernetzt sein.

Die neue Software wird vorerst unter Nutzung der bisherigen Funkgeräte, wie dem SEM 93, laufen. In einer nächsten Phase der Digitalisierung sollen sie gegen neue Funkgeräte ausgetauscht werden.
Bundeswehr/Marco DorowDie Vernetzung militärischer Einheiten des Deutschen Heeres soll künftig durch Battle Management Systeme (BMSBattle Management System, dt.: Führungsinformationssystem) ermöglicht werden. Mit ihnen gelingt das präzise Führen militärischer Operationen. Es vernetzt die Kommandanten der Fahrzeuge mit den Unterstützungseinheiten und Verbündeten. So entsteht ein digitales Lagebild, auf dessen Basis taktische Entscheidungen binnen kürzester Zeit getroffen werden können. Bis 2023 soll das neue digitale Führungssystem für die Schnelle Eingreiftruppe der NATONorth Atlantic Treaty Organization vollständig eingeführt sein. Dann übernimmt Deutschland die Führung dieser Eingreiftruppe, der Very High Readiness Joint Task Force#en (VJTFVery High Readiness Joint Task Force). Das BMSBattle Management System basiert auf der in anderen NATONorth Atlantic Treaty Organization-Ländern verbreiteten Softwarefamilie Sitaware. Nach Abschluss der Evaluierung hatte der Testverband in Munster eine individuelle Empfehlung für das Produkt Sitaware der dänischen Firma Systematic abgegeben. Die Software soll erst einmal auf den bereits vorhandenen Führungssystemen des Heeres laufen.
Zusätzlich ermöglicht das BMSBattle Management System die Verbindung zu anderen Sensoren und Effektoren, wie Kameras und Drohnen, im Gefecht, wodurch beispielsweise zeitnah Luftbildaufnahmen zur Verfügung gestellt werden können. Am Ende entsteht ein aktuelles Lagebild, individuell angepasst an die Bedürfnisse des Bedieners, vom Soldaten auf dem Gefechtsfeld bis hin zum Führungspersonal in der Operationszentrale. Später soll auch die Hardware angepasst werden. Denkbar ist in der Zukunft auch die Nutzung von sogenannten Software Defined Radios als leistungsfähige technische Basis, um Informationen auf allen Ebenen einfacher austauschen zu können. Dabei handelt es sich um leistungsfähigere Hochfrequenzsender und -empfänger, die mit besonderer Software Signale verarbeiten und verschlüsseln.
Raus aus dem Labor, rein in die Truppe. Bei dem im letzten Jahr neu aufgestellten Test- und Versuchsverband in Munster wählt das Heer einen neuen Ansatz. Bereits verfügbare digitale Technologien, die die Truppe noch nicht kennt, sollen praxisnah von den Soldaten selbst erprobt werden. Die Einbindung der Nutzer hat ganz klare Vorteile.

Auf einem Übungsplatz bei Munster testet die Truppe digitale Führungssysteme
Bundeswehr/Mario BährMit dem Test- und Versuchsverband in Munster geht das Heer einen Schritt in Richtung Digitalisierung. Der Test- und Versuchsverband soll neue, digitale Führungstechnologien der Zukunft testen. Das Stichwort heißt User Experience, sprich Nutzererfahrung, denn die Truppe probiert die Technologien selbst aus. Ihre Empfehlungen und Wünsche werden erfasst und bei der Beschaffung und Produktentwicklung berücksichtigt.

Neben den praktischen Tests der Truppe müssen sich die digitalen Technologien in einem Labor der Wehrtechnischen Dienststelle beweisen
Bundeswehr/Torsten KraatzIm Lager Trauen, einer Kaserne bei Munster, haben die Soldaten die Test- und Versuchsphasen vorbereitet. Um das richtige System für das Heer zu finden, werden insgesamt 50 Gefechtsfahrzeuge mit der benötigten Hardwarebasis ausgestattet. Sind die Fahrzeuge mit den Geräten eingerüstet, stellen verschiedene Hersteller ihre Produkte, im Fall des BMSBattle Management System eine Softwarelösung, zu Verfügung. Die Systeme werden dann unter taktischen und objektiven Kriterien, kombiniert mit den individuellen Anforderungen der Truppe und deren Material, getestet. Das bedeutet, jedes Produkt erhält die gleichen Chancen, sich zu bewähren. Die Truppe testet es nach einem standardisierten, normierten und justiziablen Verfahren auf Herz und Nieren.
Am Ende der Tests und nach Abschluss der Evaluierung spricht die Truppe ihre individuelle Produktempfehlung aus, die dann in den Beschaffungsprozess einfließt. So schnitt im Fall des BMSBattle Management System das Produkt Sitaware der dänischen Firma Systematic am besten bei den Soldaten ab. Für die Beschaffung selbst ist jedoch das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBwBundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr) in Koblenz zuständig. Dort werden die Produkte parallel im Labor der Wehrtechnischen Dienststelle geprüft. Die Einbindung der Truppe hat aber ganz klare Vorteile: So erhalten die Soldaten später genau das richtige Produkt, das sie für ihren Auftrag benötigen und ihre Erfahrungen und Bedürfnisse können zusätzlich in der Produktentwicklung mit einfließen.

Der Tag der Digitalisierung im Dezember 2020 wird Besuchern Einblicke in den Stand der Technik bei der Bundeswehr bieten. Oft nutzen Politiker die Gelegenheit, wie hier Kanzlerin Angela Merkel in Munster, sich bei der Truppe direkt zu informieren.
Bundeswehr/Sebastian WilkeFür digitale, landbasierte Operationen von morgen müssen auch Soldaten unterstützender Einheiten eingebunden werden. Daher sind in Munster auch regelmäßig Soldaten der Luftwaffe, der Streitkräftebasis, des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr und des Kommandos Cyber- und Informationsraum auf dem Übungsplatz anwesend. Bei den Tests soll das Zusammenspiel mit den Heereskräften in landbasierten Operationen simuliert und daraus wichtige Erkenntnisse gewonnen werden. Am 7. Dezember 2020 wird der erste „Tag der Digitalisierung“ stattfinden, sozusagen eine Art Informations- und Lehrübung Digital für die digitalen Vorhaben der Bundeswehr. Zwei Jahre nach dem Startschuss der Digitalisierung des Heeres erhalten Vertreter aus Bundeswehr, Politik und Wirtschaft einen Überblick über das Erreichte sowie einen Ausblick auf zukünftige Rüstungsvorhaben.

"Unsere Soldaten sollen sagen, was gut ist und nicht ein technischer Oberregierungsrat oder ein Oberst. Am Ende des Tages muss der Soldat damit umgehen können."
Der Leopard 2 ist das Waffensystem der Panzertruppe der Bundeswehr.

Der Schützenpanzer Puma, das neue Waffensystem der Panzergrenadiere.
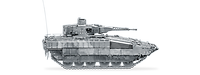
Das Battle Management System ist die neue streitkräftegemeinsame Technologie zur Digitalisierung landbasierter Operationen. Es wird unter anderem bei der Panzergrenadierbrigade 37 aus Frankenberg eingeführt. Für die VJTFVery High Readiness Joint Task Force 2023 wird das System …

Das Network Operations Center (NOC) ist das digitale Herz einer Großübung oder eines Einsatzes. Es dient der zentralen Betriebsunterstützung eines Computernetzwerks.
Bundeswehr/Thomas Ströter
Unter der Erde: Ein Soldat hilft mit ITInformationstechnik-Technik aus seinem Versteck heraus Fallschirmjägern bei der Aufklärung
Bundeswehr/Gerrit Burow
Ein Panzergrenadier kontrolliert seine Ausstattung. Mit dem System Infanterist der Zukunft - Erweitertes System Panzergrenadier (IDZ) ist er digital mit dem Schützenpanzer Puma und seinen Kameraden verbunden.
Bundeswehr/Maximilian Schulz
Neu und kampfstark: Der Schützenpanzer Puma steht digital für einen Quantensprung in der Gefechtsführung
Bundeswehr/Sebastian Wilke
Längst bereiten sich die Soldaten des Heeres auch digital auf die Gefechtsführung vor
Bundeswehr/Montage
Sie ist eine der kleinsten der Welt: Die knapp 20 Gramm schwere Drohne PDPrivatdozent-100 Black Hornet ist eine sogenannte Nano-Drohne für unbemerkte Überwachung.
Bundeswehr/Jana Neumann
Wirklichkeit und Realität verschmelzen in einer Augmented-Reality-Brille. Erst in der Zukunft wird sie im Einsatz genutzt werden können.
Bundeswehr/Jana Neumann
Generalleutnant Jörg Vollmer (r.) besucht den Test- und Versuchsverband im niedersächsischen Munster - ein wichtiges Digitalisierungsprojekt. Hier wird ein neues Battle Management System getestet, ein Führungssystem für das Gefecht von morgen.
Bundeswehr/Marco Dorow
Technisch gleicht das GTKGepanzertes Transport-Kraftfahrzeug Boxer in der Sanitätsvariante einem modernen Notarztwagen. Digital wird er taktisch voll in das Gefecht integriert.
Bundeswehr/Marco Dorow
Auch im digitalen Umfeld besticht der Kampfpanzer Leopard mit enormer Feuerkraft
Bundeswehr/Marco Dorow