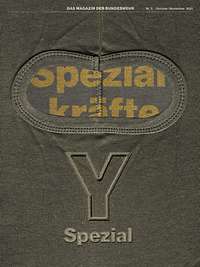
Neues Y-Spezial ist da
Das Spezial dreht sich um ein Thema: Spezialkräfte
Das Einsatzführungskommando der Bundeswehr (EFK) führt die Spezialkräfte in den Auslandseinsätzen. Im Interview erklärt dessen Befehlshaber, Generalleutnant Erich Pfeffer, wie die Einsätze entstehen und wie die Zusammenarbeit mit den konventionellen Kräften und internationalen Partnern abläuft.
Das EFK führt die Spezialkräfte im Einsatz. Was bedeutet das konkret?
Wir stellen mit der Abteilung Spezialoperationen die operative Ebene dar. Nationale Einsätze werden von hier geführt. Bei multinationalen Einsätzen übernimmt das dafür eingesetzte multinationale Führungskommando die Operationsführung. Dann kümmern wir uns um den deutschen Beitrag, um die personellen und materiellen Grundlagen und die Einhaltung des Rechtsrahmens. Bei Spezialoperationen ist die Führung durch das EFK sehr eng. Wir sprechen täglich mit dem Kontingentführer, um grundsätzliche Linien abzustimmen und Krisenthemen zu besprechen.
Bei Spezialoperationen ist die Führung durch das EFK sehr eng. Wir sprechen täglich mit dem Kontingentführer.
Das EFK hat ein eigenes Lagezentrum für Spezialkräfteoperationen. Gibt es eine 24-Stunden-Beobachtung?
Der Führer vor Ort hat die taktische Verantwortung. Im Normalfall informiert er uns über ein festgelegtes Meldewesen. Für Krisen und Komplikationen sind wir rund um die Uhr besetzt. Die Abteilung Spezialoperationen ist immer ansprechbar. Das gilt für das gesamte Kommando. Es kann passieren, dass ich nachts um drei Uhr angerufen werde, um mit einem Kontingentführer zu sprechen.
Wie kommt der Einsatz von Spezialkräften zustande?
Grundsätzlich läuft es genauso ab wie bei konventionellen Kräften. Bei exekutiven Einsätzen gelten der Parlamentsvorbehalt und der festgelegte Rechtsrahmen. Wenn die politische Führung den Einsatz von Spezialkräften erwägt, entwirft das Einsatzführungskommando der Bundeswehr einen „operativen Ratschlag“, der die Optionen im Einsatzland zeigt. Wenn die Entscheidung gefallen ist, beginnen wir mit der Ausplanung. Welche Verbände kommen infrage und welche ergänzenden Kräfte aus dem Operationsverbund der Spezialkräfte? Aus dem breiten Mix an Fähigkeiten konfigurieren wir den Einsatz.
Wie läuft die Abstimmung mit dem Kanzleramt, Ministerien und dem Parlament ab?
Es gilt der ressortgemeinsame Ansatz. Der Abstimmungsmechanismus zwischen den Ministerien ist klar geregelt. Das Auswärtige Amt hat bei nationalen Spezialkräfteeinsätzen die Federführung. Dort gibt es ein Krisenreaktions-zentrum zur nationalen Risiko- und Krisenvorsorge. Nach Bedarf werden andere Ressorts und nachgeordnete Bereiche, wie das Einsatzführungskommando oder die Bundespolizei, eingebunden. Dem Bundestag legen wir alles offen, auch geheimhaltungsbedürftige Aspekte. Das erfolgt über die Obleute der Ausschüsse für Verteidigung und des Auswärtigen. Hier herrscht völlige Transparenz.
Wer trifft am Ende die Entscheidung, etwa beim Zugriff?
Ich kann darauf nur allgemein antworten. Die grundsätzliche Entscheidung wird in der Operationsführung getroffen. Auf welcher Ebene, das hängt von der Art der Operation und der Zielperson ab. Multinationale Entscheidungen brauchen immer eine nationale Zustimmung.
Die Spezialkräfte der Bundeswehr haben den Abzug der deutschen Soldatinnen und Soldaten aus Afghanistan abgesichert. Warum war das nötig?
Es war eine Vorsichtsmaßnahme, falls das Kontingent von den Taliban angegriffen würde. Die Sicherung des Feldlagers lag bei den konventionellen Kräften. Die Spezialkräfte haben vor allem ihre Kontakte zu den afghanischen Kameraden genutzt, um Zugang zum Lagebild der Region zu bekommen und Einfluss auf afghanische Operationen zu nehmen. Über die Jahre hat sich ein enges Verhältnis entwickelt, vor allem zur Polizei. Wir haben mehrere afghanische Einheiten aufgebaut, ausgebildet und in ihren Einsätzen begleitet.
Nachdem die Bundeswehr aus Afghanistan abgezogen ist, verlagert sich der Fokus auf Afrika. Welchen Beitrag leisten die Spezialkräfte dort?
Die Maßnahmen in Afrika sind Teil der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Auch hier geht es um Military Assistance, also darum, Spezialkräfte eines Landes zu befähigen, selbst für Stabilität zu sorgen. Schwerpunktland ist derzeit Niger. Die Ausbildung wird gerade weiterentwickelt: Die nigrischen Spezialkräfte sollen nicht nur ausgebildet, sondern auch bei Operationen begleitet werden, um ihre Fähigkeiten besser evaluieren zu können.
Worauf kommt es bei der Zusammenarbeit mit einheimischen Kräften an?
Es geht vor allem um Vertrauensbildung. Vertrauen entsteht durch gemeinsam durchlebte Erfahrungen. Die Ausbildung muss sich zudem am Machbaren orientieren: Alle Einheiten sollen dasselbe Niveau und die richtige Ausstattung haben, also landestypisches Gerät, das die Partner selbst betreiben und Instandsetzen können. Unsere Spezialkräfte sollen ertüchtigen, aber die Sicherheitslage können nur die einheimischen Kräfte nachhaltig verbessern.
Was unterscheidet Spezialkräfte von der normalen Truppe?
Spezialkräfte haben eine besondere Ausbildung und werden für besonders riskante Aufträge herangezogen. Das braucht viel Idealismus und Willensstärke. Wer sich der Aufgabe nicht voll verschreibt, kann mit der Intensität nicht Schritt halten. Ich merke immer wieder eine enorme Motivation bei den Soldaten und ein kritisches Hinterfragen der eigenen Arbeit.
Spezialkräfte sind also nicht die Rambos der Truppe?
Nein, eine Rambo-Mentalität wäre völlig falsch. Spezialkräfte wenden immer nur das Maß an Gewalt an, das notwendig ist. Sie sind sehr schnell einsetzbar und operieren meist geheim, um die Überraschung als taktischen Vorteil zu nutzen.

Nach dem 11. September 2001 hat das KSKKommando Spezialkräfte in Afghanistan Kampfeinsätze gegen al-Qaida und die Taliban durchgeführt. Später verlagerte sich der Auftrag auf die Ausbildung afghanischer Verbände.
Bundeswehr/KSK
Aufklärungs-/Gefechtsfahrzeuge (AGF), Motorräder (Krad, Kraftrad) und Geländefahrzeuge (ATV, All-Terrain-Vehicles) beim taktischen Fahrtraining in der Wüste
Bundeswehr/KSKWie läuft das Zusammenspiel von Spezialkräften und konventionellen Kräften?
Wir haben häufig parallele Einsätze von Spezialkräften und herkömmlichen Kräften. Die Führungsstränge sind oft getrennt. Die Aufträge sollen sich aber ergänzen, dafür ist eine enge Abstimmung auf allen Ebenen nötig. Spezialkräfte können auch autark agieren. Mit der Unterstützung konventioneller Kräfte – zum Beispiel durch Bereitstellen einer logistischen Basis – sind sie jedoch wesentlich durchhaltefähiger.
Wie ist die Zusammenarbeit mit den Verbündeten?
Die multinationale Zusammenarbeit ist sehr eng. Die westlichen Einheiten sind eine große Familie. Man kennt sich aus der Ausbildung, von Übungen und durch gemeinsame Einsätze. Es gibt eigentlich keinen Bereich, in dem sie nicht zusammenarbeiten. Im Einsatz tauschen wir mindestens unser Lagebild aus. Das gilt auch für den Austausch mit den Einheiten in Deutschland, die für das nationale Risiko- und Krisenmanagement bereitstehen.
Derzeit läuft eine Strukturuntersuchung der Spezialkräfte. Worum geht es?
Wir wollen Prozesse und Strukturen verbessern und befinden uns auch dafür im Austausch mit Partnerspezialkräften. Es geht um die Führung, Aufstellung und Ausbildung des Gesamtsystems Spezialkräfte der Bundeswehr. Das System funktioniert gut, aber wir können an der ein oder anderen Stellschraube noch drehen.
Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht, zu erfahren, was die Spezialkräfte tun. So können wir falschen Mythen entgegenwirken.
Sollte der Nutzen der Spezialkräfte öffentlich besser erklärt werden?
Ja, die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht zu erfahren, was die Spezialkräfte tun. Auf dem Balkan und in Afghanistan haben sie wichtige Festnahmen von Zielpersonen durchgeführt. Wir müssen Verständnis in der Bevölkerung dafür schaffen, welchen Mehrwert die Spezialkräfte für unsere Sicherheit haben. Ich bin auch dafür, nach dem Ende von Einsätzen eine Nachschau zu machen. So können wir falschen Mythen entgegenwirken.
Gibt es Grenzen bei der Transparenz?
Ja, die erste Grenze ist der Persönlichkeitsschutz der Soldaten. Eine andere ist die Geheimhaltungsbedürftigkeit konkreter Operationen. Zudem müssen wir Rücksicht auf multinationale Verfahren nehmen. Hier gelten weltweite Regeln, die wir beachten müssen.
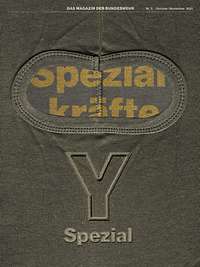
Das Spezial dreht sich um ein Thema: Spezialkräfte